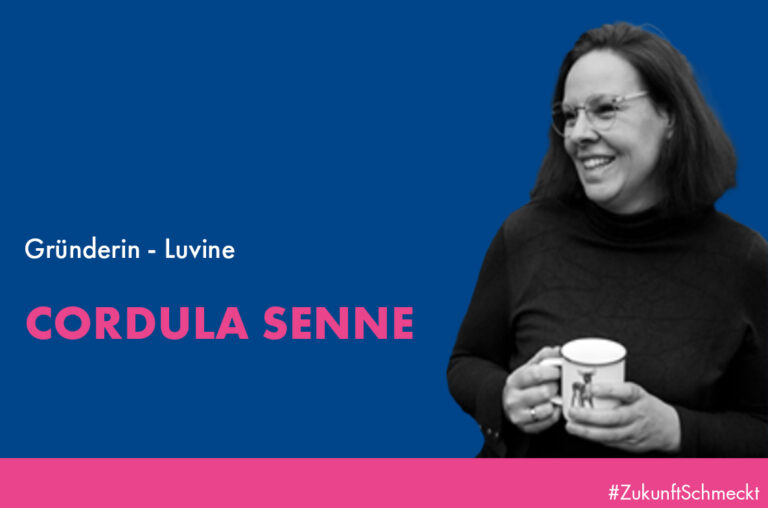Nadia Röwe leitet das Referet „Gesunde Ernährung“ im BZfE. Sie weist auf die Bedeutung des Mikronährstoffs Jod und die Verwendung von Jodsalz zur ergänzenden Deckung des Jodbedarfs hin.
Frau Röwe, warum ist gerade Speisesalz das Produkt, das für die Jodierung genutzt wird?
Nadia Röwe: Das Lebensmittel Salz eignet sich sehr gut als „Jodträger“, da es die meisten Menschen täglich für ihre Ernährung nutzen – in gut definierbaren Mengen und unabhängig von zum Beispiel Bildung und Einkommen. Außerdem wird es manchen Produkten bei der industriellen und handwerklichen Verarbeitung zugegeben.
Können Lebensmittelhersteller Jodsalz problemlos anstelle von nichtjodiertem Salz zur Produktion von Lebensmitteln verwenden? Oder bestehen gesundheitliche Risiken, zum Beispiel wenn Verbraucher zu viel Jod aufnehmen würden?
Nadia Röwe: Jodsalz kann genauso wie nichtjodiertes Salz bei der Lebensmittelverarbeitung und -zubereitung eingesetzt werden. Die Jodmenge, die Speisesalz zugegeben werden darf, ist rechtlich geregelt und liegt derzeit bei 15 bis 25 Milligramm Jod pro Kilogramm Salz. Die Jodmenge ist so gewählt, dass bei einer üblichen Salzaufnahme gesundheitliche Beeinträchtigungen für gesunde Menschen jeden Alters sowie für Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen sehr unwahrscheinlich sind. Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen sollten jedoch gegebenenfalls auf zusätzliche Jodaufnahmen über die Ernährung mit Jodsalz und mit Jodsalz hergestellten Lebensmitteln hinaus – wie jodhaltige Nahrungsergänzungsmittel – verzichten. Eine ärztliche Beratung kann im Zweifel helfen.
Gibt es Überempfindlichkeiten oder Allergien gegenüber Jod?
Nadia Röwe: Allergien und Unverträglichkeiten spielen bei der Verwendung von Jodsalz keine Rolle. Zwar können jodhaltige Produkte wie Röntgenkontrastmittel oder Wunddesinfektionsmittel Allergien auslösen, als Allergen wirkt aber in diesen Fällen der Trägerstoff, an den Jod gebunden ist. Unverträglichkeitsreaktionen gegenüber Jod können auftreten, wenn dauerhaft tägliche Jodmengen im Milligramm- oder Grammbereich, also weit oberhalb der Jodzufuhr auf Basis der Jodmangelprophylaxe, aufgenommen werden. Eine Jodzufuhr in dieser Größenordnung kann beispielsweise durch die Einnahme jodhaltiger Medikamente oder den Verzehr getrockneter Meeresalgen zustande kommen.
 Quelle: Nadia Röwe
Quelle: Nadia RöweMuss auf die Verwendung von Jodsalz auf der Verpackung hingewiesen werden?
Nadia Röwe: Es gibt die rechtliche Verpflichtung, den Einsatz von Jodsalz im bei vorverpackten Lebensmitteln vorgeschriebenen Zutatenverzeichnis zu kennzeichnen. Dabei kann es gemäß der sogenannten Lebensmittel-Informationsverordnung, kurz LMIV, auf zwei Arten im Zutatenverzeichnis aufgeführt werden:
- in Form seiner Einzelzutaten: „Salz“ sowie der konkret genutzten Mineralstoffverbindung, zum Beispiel „Kaliumjodat“;
- als zusammengesetzte Zutat: „Jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Natriumjodat)“ oder „Jodsalz (Salz, Kaliumjodat)“.
Ein gesonderter Hinweis, etwa „mit Jodsalz“, muss im Falle einer Verwendung von Jodsalz nicht auf dem Etikett stehen.
Das Kennzeichnungsrecht sieht vor, dass jodiertes Salz als „Natriumjodat“ oder „Kaliumjodat“ gekennzeichnet wird. Einige Hersteller befürchten, dass Verbraucher diese Zutat als zu „chemisch“ wahrnehmen könnten. Verstehen Sie die Forderung der Hersteller, das Kennzeichnungsrecht zu vereinfachen?
Nadia Röwe: In gewissen Grenzen ja, da vor Inkrafttreten der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) eine vereinfachte Kennzeichnung von Jodsalz möglich war – auch wenn Verbrauchende in der Regel ausführlich über Zutaten informiert werden wollen und „chemisch“ klingende Begriffe bei Lebensmitteln keine Seltenheit sind. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) unterstützt grundsätzlich den Wunsch der Wirtschaft nach einer Vereinfachung der Kennzeichnung von jodiertem Speisesalz und hat sich bereits mehrfach und auf unterschiedlichen Ebenen in Brüssel dafür eingesetzt.
Ist Jodsalz nach Ihrer Kenntnis im Einkauf für die Industrie teurer als nichtjodiertes Salz?
Nadia Röwe: Laut einer im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) durchgeführten Studie der Justus-Liebig-Universität Gießen aus dem Jahr 2017 sind mit Jod angereicherte Salze im Vergleich zu (nichtjodiertem) Siedesalz geringfügig teurer (meist um wenige Cent pro 100 Gramm), im Vergleich zu anderen Salzarten wie Steinsalz oder Meersalz jedoch deutlich preiswerter. Die Ergebnisse dieser Studie sowie weiterer Befragungen des Max Rubner-Instituts (MRI) aus dem Jahr 2024 deuten darauf hin, dass der Preis von Jodsalz für die befragten Lebensmittelbetriebe überwiegend kein Argument gegen die Verwendung von Jodsalz darstellt.
Bestehen bei der Verarbeitung von Jodsalz Risiken in der Lebensmittelproduktion, die mit nichtjodiertem Salz nicht bestehen, zum Beispiel in den Maschinen oder im Endprodukt (anderer Geschmack, andere Konsistenz, Verfärbung)?
Nadia Röwe: Uns sind keine Risiken für die Lebensmittelproduktion bei der Verarbeitung von Jodsalz bekannt. Die Verfügbarkeit von Jod aus jodiertem Salz kann allerdings stark schwanken, wie eine Studie des Max Rubner-Instituts zeigt. Für die küchentechnische Verwendung ist Folgendes zu beachten:
- Fermentieren, zum Beispiel bei der Herstellung von Sauerkraut oder Kimchi, funktioniert mit Jodsalz genauso wie mit nichtjodiertem Speisesalz. Jodsalz beeinflusst den Geschmack nicht. Auch andere Produkteigenschaften werden bei der Verwendung von Jodsalz im Vergleich zu nichtjodiertem Speisesalz nicht negativ beeinflusst.
- Beim Einkauf von Jodsalz auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten. Nach dessen Ablauf ist das Salz noch verwendbar – der Jodgehalt kann abhängig von Lagerort und -bedingungen aber leicht zurückgehen.
- Jodsalz trocken lagern. Dazu gehört auch, dass die geöffnete Packung entfernt von Dunstquellen steht (zum Beispiel Herde, Dampfgarer), wo sich Feuchtigkeit bildet. Diese reduziert auf Dauer den Jodgehalt im Jodsalz.
- Jodsalz geht beim Zubereiten aus dem Kochwasser in Lebensmittel wie Nudeln, Kartoffeln, Reis oder Quinoa über. Die Vollkornvariante nimmt Jod genauso gut auf. Geschälte und in kleine Stücke geschnittene Kartoffeln sowie festkochende Sorten nehmen Jod besser auf als ungeschälte, ganze und mehlig kochende Knollen.
- Einfrieren, Lagern, Auftauen, Erhitzen oder Aufbacken von jodsalzhaltigen Lebensmitteln verändert deren Jodgehalt nicht.
Dürfen Lebensmittelhersteller, die Jodsalz in ihren Produkten verwenden, damit auf der Verpackung werben und den zusätzlichen gesundheitlichen Vorteil ausloben?
Nadia Röwe: Hier sind drei Aspekte zu beachten:
- Ein einfacher Hinweis darauf, dass Jodsalz zur Herstellung eines Lebensmittels verwendet wurde – also die Angabe „mit Jodsalz“ – ist nach der Rechtsprechung eine Beschaffenheitsangabe und keine nährwertbezogene Angabe. Soweit die Aussage stimmt, ist sie zulässig.
- Eine gesundheitsbezogene Angabe kann gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 (Health-Claims-Verordnung, HCVO) verwendet werden, sofern sie von der EU-Kommission genehmigt wurde und die Verwendungsbedingungen eingehalten werden. Die für Jod zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben mit den entsprechenden Verwendungsbedingungen sind im Register der EU-Kommission aufgeführt, zum Beispiel die Angabe „Jod trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei“.
- Nährwertbezogene Angaben sind zulässig, sofern die Voraussetzung des Anhangs der HCVO eingehalten wird. Damit sind zum Beispiel Angaben gemeint wie „enthält Jod“ oder „jodreich“.
Gibt es bereits Erfahrungen von Lebensmittelherstellern in Deutschland oder Europa mit der generellen Verwendung von Jodsalz anstelle von nichtjodiertem Salz?
Nadia Röwe: Ja, denn in Europa und auch weltweit gibt es zahlreiche Länder, in denen Jodsalz in der Lebensmittelproduktion eingesetzt wird. Dazu zählen zum Beispiel die Schweiz, Österreich, Schweden, Finnland und die USA. Eine effektive Jodmangelprophylaxe über jodiertes Speisesalz hat dort zur Verbesserung der Jodversorgung beigetragen. Das galt bis in die 2000er-Jahre auch für Deutschland. Seitdem ist die Verwendung von Jodsalz zurückgegangen, auch weil immer weniger Jodsalz bei der Lebensmittelherstellung eingesetzt wird – zu Lasten der Jodversorgung der Menschen in Deutschland, wie Studien des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen.
Tatsächlich gibt es in den verschiedenen europäischen Ländern unterschiedliche Vorgaben für die Verwendung von Jodsalz, was dessen Einsatz in der Lebensmittelproduktion für international tätige Unternehmen erschwert. Wird hier an einer Harmonisierung gearbeitet?
Nadia Röwe: Die zentrale Strategie, Speisesalz mit Jod anzureichern und damit Jodmangel vorzubeugen, wurde von vielen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt. Dabei variieren die zugelassenen Jodverbindungen je nach nationalen Vorgaben. Neun Länder in der EU verfolgen eine Politik der obligatorischen Verwendung von jodiertem Salz. Darüber hinaus wird in einigen Ländern empfohlen, Brot und Backwaren oder andere verarbeitete Lebensmittel mit jodiertem Salz herzustellen. Aufgrund einer uneinheitlichen Datenlage zur Schätzung der Jodaufnahme ist eine EU-weite Harmonisierung von Mindestmengen für Jod in Salz derzeit nicht absehbar.
Das BMEL versucht dennoch, die Wirtschaft zu unterstützen, und ist auch bereit, auf andere Mitgliedstaaten zuzugehen, um auf eine Anerkennung von mit Jodsalz hergestellten Lebensmitteln aus Deutschland im EU-Ausland hinzuwirken.
Gerade wird auf EU-Ebene die Festlegung von Höchstmengen für Jod einschließlich Jod in Speisesalz diskutiert. Das BMEL setzt sich dafür ein, dass Höchstmengen für Jod in Speisesalz festgelegt werden, da das die Akzeptanz aller Mitgliedstaaten für eine sichere Verwendung von jodiertem Salz steigern, die Jodversorgung verbessern und damit auch Handelshemmnisse abbauen würde.
Frau Röwe, wir danken für das Gespräch.
Mehr Informationen und Material zur Kampagne finden sich hier.
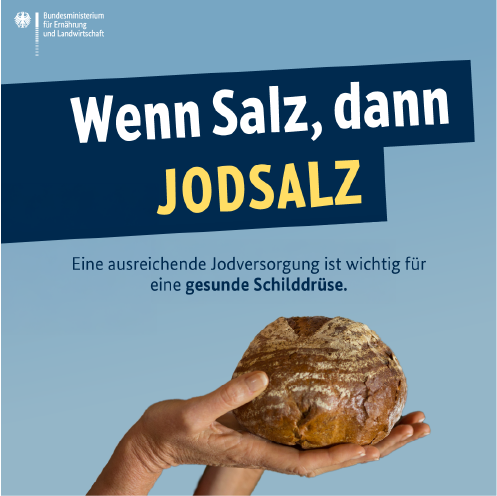 Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)