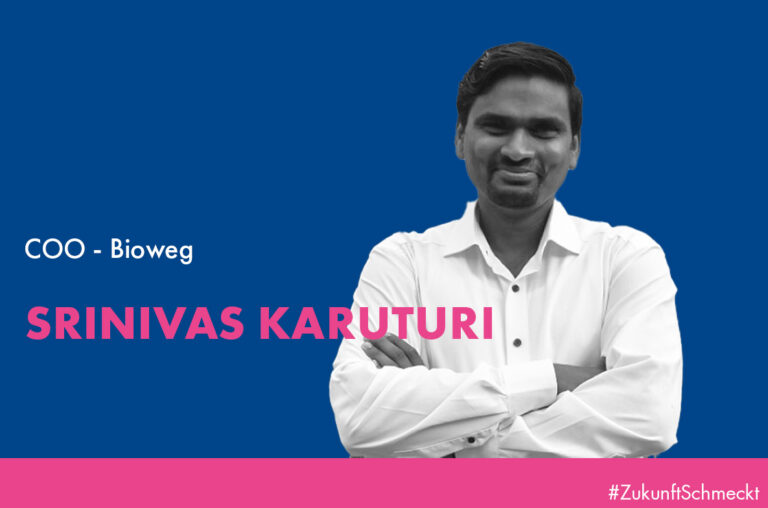Ist Brot weiterhin das Grundnahrungsmittel der Deutschen?
Tobias Schuhmacher:
Die Deutschen lieben ihr Brot. Doch aktuell stagnieren die Umsatzzahlen und sind in manchen Betrieben teilweise rückläufig. Langfristig ist aber ein Wachstum erkennbar: 2022 lag der Umsatz der Brotbranche bei 23 Milliarden Euro. 2021 waren es noch 20 Milliarden Euro. Das Lieblingsbrot der Deutschen ist nach wie vor das Toastbrot, gefolgt von Mischbrot und Broten mit Körnern und Saaten.
Durch gestiegene Energie-, Rohstoff- und Personalkosten ist auch Brot in den vergangenen Jahren teurer geworden. Wie ist Ihre Prognose?
Tobias Schuhmacher:
Wir haben 2 Arten von Mitgliedern: Die so genannten Lieferbäcker liefern direkt in den Handel. Und zum anderen haben wir die großen Filialisten. Das sind die Unternehmen, in denen das Brot über die Theke geht, etwa an Bahnhöfen oder Flughäfen. Lieferbäcker und Filialisten sind unterschiedlich betroffen. Der Handel ist als größter Abnehmer ein kraftvoller Vertragspartner, der sich höhere Kosten nicht einfach überbürden lässt. Von daher würde ich nicht unterschreiben, dass die Kostensteigerungen im Handel daher rühren. Bei den Filialgeschäften machen Personalkosten den größten Teil aus.
Rund 80 Prozent des deutschen Brotes wird im Einzelhandel verkauft. Wie werden hier die Preise festgelegt und was wünschen Sie sich vom Handel?
Tobias Schuhmacher:
Es gibt eine starke Abhängigkeit vom Handel, was faire Preisverhandlungen schwierig macht. Da wünsche ich mir mehr Miteinander, dass wir versuchen, die Dinge gemeinsam anzupacken. Ein Beispiel ist das Thema Nachhaltigkeit. Der Handel fordert, dass Unternehmen bis zu einem Zeitpunkt X bestimmte Klimaziele erreichen sollen. Es wird aber nicht erklärt, wie es gehen soll und wer die Kosten dafür trägt. Wir sollten für Themen, für die wir gesamtgesellschaftlich verantwortlich sind, mehr an einem Strang ziehen. Der Handel sollte hier auch seinen Beitrag leisten und seine Lieferanten auf dem Weg mitnehmen.
Alexander Meyer-Kretschmer:
Der IFS zeigt, wie es gehen kann. Das ist ein Standard, der ursprünglich vom Handel gesetzt wurde und vorgibt, wie IFS-Mitglieder produzieren sollen. Diese Vorgaben waren zu Beginn teilweise recht praxisfern. Nun sind im IFS auch Personen vertreten, die mit den Großbäckern zu tun haben und Informationen aus der Praxis einbringen. Das ist ein Best Practice dafür, dass man Forderungen nicht ohne die entsprechende Branche erarbeiten sollte, sondern deren Sachkenntnisse nutzen, um das Ganze zu gestalten.
Wie reagieren Verbraucher auf Preisunterschiede beim Brot?
Tobias Schuhmacher:
Viele Kunden müssen auf den Preis achten. Da macht es einen Unterschied, ob ich für 500 Gramm Brot im Handel 1,99 Euro bezahle oder das Doppelte beim Handwerksbäcker. Wir brauchen bezahlbare Lebensmittel und von daher kann ich mir vorstellen, dass der Handel in der Gesamtsumme sehr spitz rechnet. Je größer das Unternehmen, desto schwieriger wird es. Der Handel arbeitet mit engen Budgets und komplexen Entscheidungsstrukturen, in denen viele Personen involviert sind.
Bäckereien sind sehr energieintensiv. Wie hat die Branche in den letzten Jahren der Energiekrise und den gestiegenen Energiekosten getrotzt?
Tobias Schuhmacher:
Es gibt zum einen technologisch getriebene Projekte, die gerade bei Neubauten gut funktionieren. Ein Beispiel ist Abwärme. Die Hitze aus dem Backprozess können Unternehmen nutzen, um das gesamte Gebäude zu heizen. Das ist genial. Andere Projekte fokussieren sich auf Einsparmaßnahmen. Hier wird genau geschaut, wann wieviel Energie gebraucht wird und es werden Preise für Strom und Gas verglichen. Unsere Öfen werden ja hauptsächlich mit Gas betrieben. Viele Unternehmen würden im Sinne des Klimaschutzes auch gern auf Strom umstellen, doch sie sagen: ‚Wenn Strom endlich bezahlbar wäre, hätten wir schon lange umgestellt.‘ Wir brauchen von der Politik Planungssicherheit.
Welche Hürden gibt es aktuell beim Thema Rohstoffe?
Tobias Schuhmacher:
Der Kakaopreis ist durch fehlende Verfügbarkeit massiv gestiegen. Kakao wird in unserer Branche vor allem in süßen Backwaren verwendet. Das zweite Thema sind bürokratische Hemmnisse. Die EUDR-Entwaldungsrichtlinie soll zum Jahresende Kraft treten. Dann müssen produzierende Unternehmen nachweisen, dass ihre Rohstoffe von entwaldungsfreien Flächen stammen. Das betrifft bei unseren Betrieben Kakao und Papier für die Verpackungen. Es gibt hier keine klare Richtlinie. Keiner weiß, was er machen soll. Da hat das Verschieben auch nur bedingt geholfen. Die Betriebe kriegen alles hin, aber sie müssen wissen wie.
Woran hapert es hier?
Tobias Schuhmacher:
Meiner Meinung nach müsste man die EUDR neu schreiben. Es fehlt einfach an praktikablen Regelungen. Ein Beispiel: Der ghanaische Kakaobauer soll eine Satellitenanlage aufstellen, damit man überwachen kann, dass er keine Waldflächen rodet. Diese Idee ist schwer nachzuvollziehen, weil der ghanaische Bauer wahrscheinlich kaum Kenntnisse über Videoüberwachung etc. hat und sich das im Zweifel gar nicht leisten kann. Und wer soll am Ende garantieren, dass die ganze Dokumentation tatsächlich so stimmt? Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz geht ja in die gleiche Richtung. Selbst eine große Bäckerei kann kaum gewährleisten, dass wirklich alles sauber bis zur Urproduktion zurückverfolgbar ist. Es steckt ein hehres Ziel dahinter, aber so weit sind wir meiner Meinung nach noch nicht. Über Jahrhunderte haben wir immer nur Wachstum vorangetrieben, jetzt versuchen wir teilweise mit der Brechstange alles wieder gut zu machen, was wir in den letzten 100 Jahren versäumt haben. Aber so auf die Schnelle wird es nicht funktionieren.
Wie wirkt sich das EU-Verbot für russischem Kunstdünger auf die Brotpreise aus?
Alexander Meyer-Kretschmer:
Die Düngeverordnung wirkt sich deutlich auf Menge und Qualität des Getreides aus. Früher kamen rund 95 Prozent unseres Roggens und Weizens aus Deutschland. Das ist heute fraglich mit den Anforderungen aus der Düngeverordnung und wie die sich auf die Qualität des Weizens auswirken. Weniger Düngung führt zu schwächerem Weizen mit niedrigerem Proteingehalt. In Dänemark wird der Löwenanteil des proteinstarken Weizens inzwischen nur noch importiert, weil der heimische Weizen zu schwach geworden sind. So etwas wünsche ich mir für Deutschland nicht – es gefährdet sowohl die Nachhaltigkeit als auch die Versorgungssicherheit.
Wie weit können sich Großbäckereien hier an den Projekten des BMEL beteiligen?
Alexander Meyer-Kretschmer:
In den Projekten schaut man sich zum Beispiel an, wie man mit einem proteinschwächeren Weizen immer noch entsprechende Backwaren produzieren kann, etwa durch Züchtung. Doch das ist alles sehr komplex. Einen großen Teil unserer Backwaren können wir mit weniger Protein im Weizen gar nicht herstellen. Dementsprechend möchten wir diese Lücke auch nicht haben. Wir sind von Anfang an an der Diskussion beteiligt gewesen und haben genau diese Argumente mit auf den Tisch gepackt. Die Quintessenz von jedem Gespräch bei der Backweizeninitiative des BMEL war, dass man gezielt Sorten auswählen muss, die für bestimmte Backprozesse geeignet sind. Ein guter Weg sind sortenspezifische Strategien für den Anbau, um mit reduzierter Düngung dennoch backfähige Proteingehalte zu erreichen.
Sehen Sie eine Chance in CrisprCas?
Tobias Schuhmacher:
Ja. Mit einer gezielten Genomeditierung könnte man viel schneller robuste Sorten mit höherer Backqualität züchten. Das halte ich für sinnvoll. Momentan haben wir Züchtungsphasen von 10 bis 15 Jahren für eine neue Sorte. Mit Crispr kann ich das wesentlich verkürzen.
Welchen Effekt haben Verpackungsregulierungen auf die deutschen Großbäckereien?
Alexander Meyer-Kretschmer:
Die neue Mehrwegpflicht stellt viele Bäckereien vor praktische Probleme. Sie verpflichtet Filialen, Mehrwegbehälter anzubieten, zum Beispiel für Kaffee. Die gesetzliche Regelung ist jedoch unklar formuliert: Gilt sie auch für Franchisenehmer? Müssen Flächen zusammengerechnet werden? Fällt eine kleine Filiale unter die Ausnahmeregelung oder nicht? Hier hätten wir uns klare Vorgaben gewünscht. In der Praxis scheitert das System oft an der Realität. Auf unserem Bäcker-Infotag war die Rückmeldung eindeutig: Ein funktionierendes Mehrwegsystem braucht flächendeckende Rückgabemöglichkeiten – wie bei Pfandflaschen. Die gibt es bislang nicht. Zwar existieren Systeme wie Recup, doch die bringen Hygieneprobleme mit sich. Wer möchte benutzte Kaffee- oder Kakaobecher an der Theke haben, die vielleicht schon zwei Tage in der Ecke standen?
Gibt es Bedenken bezüglich der kommunalen Verpackungssteuern?
Tobias Schuhmacher:
Es gibt ja bisher nur eine Stadt, die diese Verpackungssteuer hat, nämlich Tübingen. Köln zieht es in Erwägung. Die Branche beobachtet das Thema, aber der Handlungsdruck scheint aus Sicht der Unternehmen aktuell gering.
Wie blicken Sie auf die Diskussionen zum PFAS-Verbot?
Alexander Meyer-Kretschmer:
PFAS wird in unserer Branche zum Beispiel in Backformen eingesetzt, damit Teig nicht kleben bleibt. Sie halten zudem hohen Temperaturen und Belastungen stand. Ein generelles Verbot wäre problematisch, denn in einigen Bereichen sind PFAS bisher kaum ersetzbar. Deshalb läuft eine wichtige Debatte: Statt eines pauschalen Verbots soll es differenzierte Regeln geben. Das unterstützen wir. Denn in manchen Fällen gibt es keine gleichwertigen Alternativen – oder sie sind teuer, weniger umweltfreundlich oder technisch ungeeignet. Ziel muss sein: Schutz von Gesundheit und Umwelt, aber mit Augenmaß. Bestehende Anlagen sollten weiter genutzt werden dürfen, bis es verlässliche Ersatzlösungen gibt.
Ein Ausblick in die Zukunft: Wie wird sich die Branche entwickeln? Was sind Ihre Ziele?
Tobias Schuhmacher:
Man hört von vielen Unternehmen: „Einfach mal in Ruhe arbeiten wäre auch schön.“ Es gibt genug zu tun: Große Kunden wollen betreut, Preise verhandelt und Tarifrunden geführt werden. Da geht es um sehr große Beträge. Zusätzliche Gesetze und neue EU-Vorgaben sind da oft eine unnötige Belastung. Beim Thema Brotpreise sehen wir große Unterschiede: Günstiges Brot im Supermarkt auf der einen Seite und Handwerksbäcker mit Preisen bis zu elf Euro pro Kilo auf der anderen. Mir fehlt in Deutschland oft die Wertschätzung für Lebensmittel – im Handel und bei den Verbrauchern. Wir geben viel weniger für Lebensmittel aus als der EU-Durchschnitt. Mein Motto: Lieber gut essen und trinken – das Leben ist schließlich endlich.